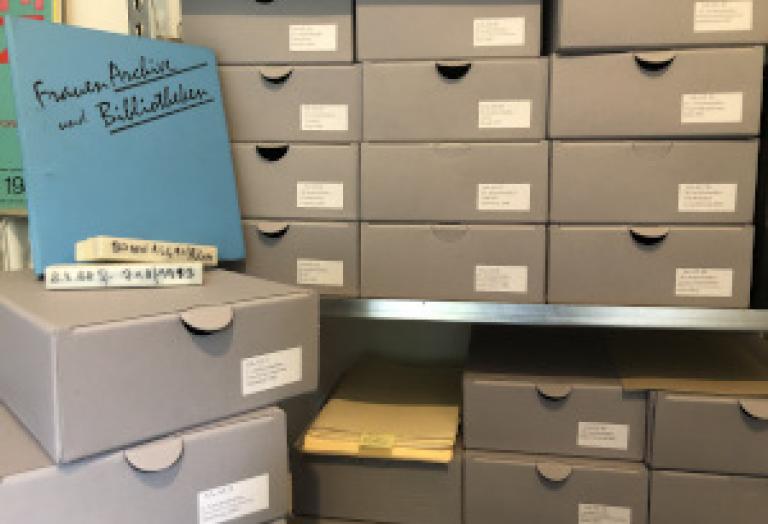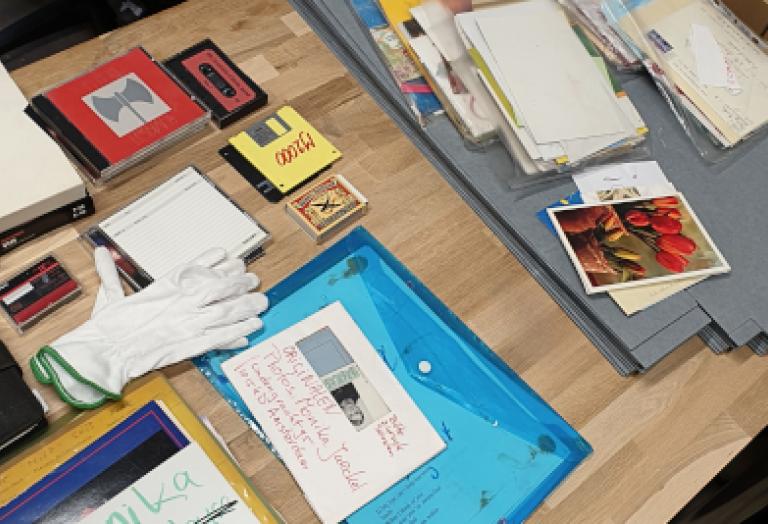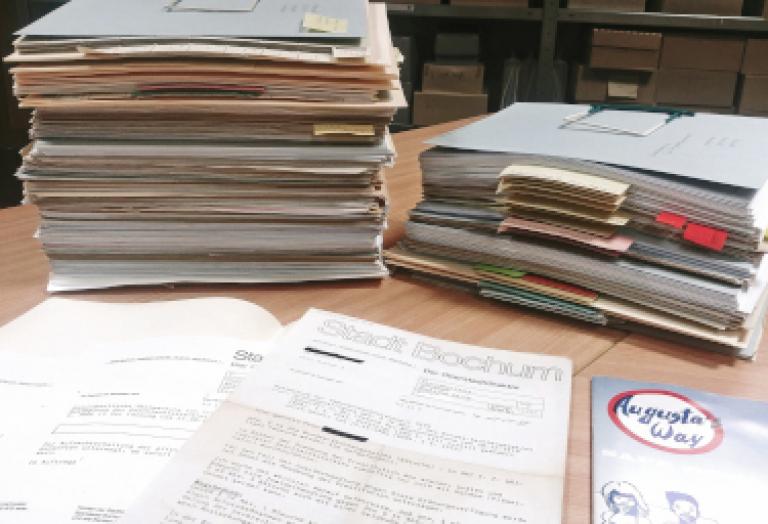Alice Shalvi (*1926) – israelische Feministin und Friedensaktivistin
„Without Shalvi and her colleagues, Israel today would be a different, less enlightened country.“(„Ohne Shalvi und ihre Kolleg*innen wäre Israel heute ein anderes, weniger aufgeklärtes Land.“, Übersetzung d. Red.)1 94-jährig schaut Alice Shalvi nicht nur auf ein reiches, vielfältiges Leben zurück. Sie bezieht weiterhin Stellung und erhebt ihre kritische Stimme gegen Diskriminierung, Rassismus und patriarchale Strukturen sowie für soziale und Geschlechtergerechtigkeit. Diesen Zielen hat sie ihr Leben gewidmet. Unterstützt wurde die Mutter von sechs Kindern dabei von ihrem Ehemann Moshe Shalvi (1929–2013). Im Interview mit Eleonore Lappin-Eppel berichtet Alice Shalvi mit der ganzen Kraft und Ausstrahlung ihrer Persönlichkeit über dieses Engagement.
Alice Shalvi wuchs in einem liberalen, jüdisch-orthodoxen und zionistischen Elternhaus auf, zunächst in Deutschland und, nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten 1934, in England. Obgleich Englisch ihre „Muttersprache“ wurde und sie Englische Literatur studierte, fühlte sie sich in England nicht zu Hause. Als Geflüchtete und Jüdin erfuhr sie auch hier Ausgrenzung und Diskriminierung. Sie entschloss sich zur Emigration nach Israel. Konkret schildert sie im Interview die Motive, Hintergründe und Erfahrungen, die ihrer Entscheidung zugrunde lagen.
Beruf und Engagement
Alice Shalvi kam 1949 mit einem B.A. der Cambridge University in English Literature und einem M.A. in Social Work der London School of Economics in den neu gegründeten Staat Israel. Dort wollte sie ein Zuhause finden, am Aufbau der Nation mitwirken und vom Holocaust traumatisierten Überlebenden helfen.
Sie wurde jedoch nicht als Sozialarbeiterin, sondern als Dozentin für Englisch gebraucht. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1990 lehrte sie Englische Literatur an der Hebrew University in Jerusalem. Ab 1969 baute sie außerdem das English Department an der neuen University of the Negev (heute Ben-Gurion-Universität) auf, von 1973 bis 1976 als dessen Direktorin. Im Interview vermittelt Alice Shalvi anregend, dass und in welcher Weise brennende politische und gesellschaftliche Fragen anhand der Dramen von Shakespeare erörtert werden können. Obwohl sie als herausragende Lehrerin galt, wurde ihr das Dekanat der Universität 1973 verweigert, „weil sie eine Frau war“. Das richtete ihr Augenmerk auf die Diskriminierung von Frauen und wurde zum Ausgangspunkt für Untersuchungen, juristische Initiativen und die Etablierung von Gender Studies.
Frauendiskriminierung und Frauenmacht
Um Gleichberechtigung ging es Alice Shalvi auch, als sie 1975 ehrenamtlich die Leitung der Pelech School übernahm, um religiös gebundenen Mädchen das – ausschließlich Jungen vorbehaltene – Studium des Talmud zu ermöglichen. Heute ist die Schule eine der angesehensten in Israel. Viele ihrer Schülerinnen geben Alice Shalvis Ideen weiter, als Lehrerinnen und Erzieherinnen, Rechtsanwältinnen, Professorinnen, Politikerinnen und Rabbinerinnen.
Shalvi verstärkte ihr feministisches Engagement mit dem Israelischen Frauennetzwerk (IWN), das sie 1984 mitbegründete und bis 2000 leitete. In ihm arbeiten Feministinnen unterschiedlicher politischer und religiöser Orientierungen zusammen. Sie decken die Diskriminierungen von Frauen auf und setzen sich für die Durchsetzung von Frauenrechten in Politik, Recht, Religion, den Medien, der Arbeitswelt, im Gesundheitsbereich und in der Armee ein. Sie haben den Status und die Lebensbedingungen von Frauen nachhaltig verändert und damit die Gesellschaft. Darüber hinaus kämpft Shalvi gemeinsam mit palästinensischen Frauen für Frieden.
Religion und gesellschaftliche Vision
Trotz ihrer Kritik an dem diskriminierenden Frauenbild des orthodoxen Judentums ist Alice Shalvi der Religion treu geblieben. 1999 wurde sie als erste Frau zur Rektorin des namhaften Schechter Institute for Jewish Studies in Jerusalem gewählt – ein Meilenstein. Heute gehört sie einer einzigartigen traditionellen Gemeinde an, die – egalitär und inklusiv – für alle offen ist. Die Gemeinde Zion, 2012 von ihrer Schülerin, der Rabbinerin Tamar Elad Applebaum gegründet, erscheint wie das Modell für Shalvis Vision eines offenen und friedlichen Israel, in dem die Kluft zwischen säkular und religiös, Juden und Arabern, Männern und Frauen überwunden ist.
Würdigungen
Alice Shalvi wurde mit unzähligen Ehrendoktorwürden und Preisen ausgezeichnet, wie dem New Israel Fund's Israel Women's Leadership Award 1994, der seitdem ihren Namen trägt, und dem Israel Prize 2007 für ihr Lebenswerk. Sie ist auch die erste Preisträgerin des Alice Salomon Award 2001, mit dessen Namensgeberin sie das Engagement für soziale und Gendergerechtigkeit teilt.
Das Interview mit Alice Shalvi wurde im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Alice Salomon Archivs und dessen Institutionalisierung sowie des Abschlusses des DDF-Projekts zur Sicherung der Quellen und Erforschung der Biografien und Spuren der „Jüdischen Schülerinnen und Dozentinnen an der Sozialen Frauenschule in Berlin (gegr. 1908) und der Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit (1925–1933)“, die zum Teil bis nach Palästina/Israel reichen, durchgeführt. Pandemiebedingt hat die Wiener Historikerin Eleonore Lappin-Eppel das Interview online geführt. Lappin-Eppel ist Vorstandsmitglied von Bet Debora, einem europäischen Netzwerk jüdisch-feministischer Frauen, in dem auch Alice Shalvi seit 2001 aktiv ist.
Literatur
- Alice Shalvi. Never a Native. London: Halban Publ. 2018.
- Eleonore Lappin-Eppel. „Alice Shalvi“ (2020); https://www.bet-debora.net/alice-shalvi/; Stand: 26.2.2021.
- Charlotte Wishlah. “Alice Hildegard Shalvi”. Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (2009); https://jwa.org/encyclopedia/article/shalvi-alice; Stand: 26.2.2021.
- „Verleihung des Alice Salomon Award an Alice Shalvi“. Sozialpädagogik und Geschlechterverhältnis 1900 und 2000, hrsg. v. A. Feustel, Berlin: ASFH 2003, S. 57-63.
Fußnoten
- 1Matthew Kalman: Through the glass ceiling: Meet Alice Shalvi, mother of Israeli feminism, in: The Times of Israel, 1.1.2019, abrufbar unter: https://www.timesofisrael.com/through-the-glass-ceiling-meet-alice-shalvi-mother-of-israeli-feminism/; Stand: 26.2.2021.