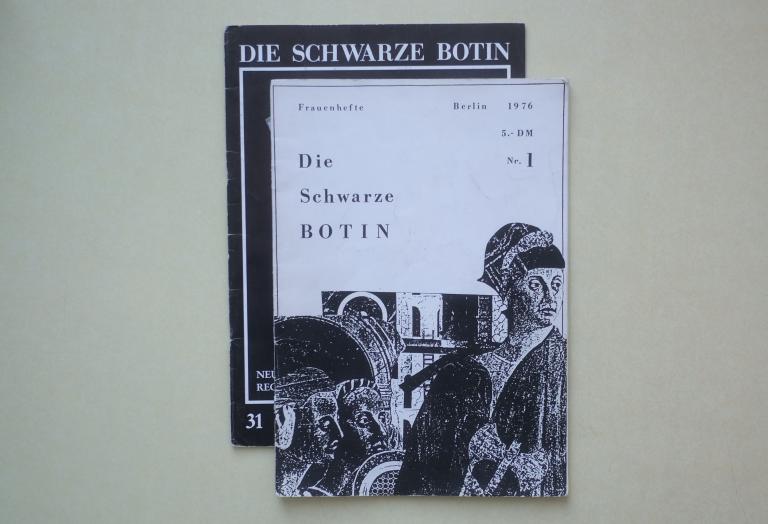Lesben jenseits der Metropolen: Vom Coming-out zur Subkultur
Setting
Wie erlebten junge Frauen im Saarland der 1960er- und 70er-Jahre ihr Coming-out? Fühlten sie sich diskriminiert? Wo fanden sie Gleichgesinnte? Was bedeuteten ihnen Frauenbewegung und lesbische Subkultur? Diesen Fragen wollte ich – selbst Zeitzeugin und Aktivistin der 1970er-Jahre – nachgehen. Zwar beherbergt das Archiv der FrauenGenderBibliothek zahlreiche Unterlagen von lokalen lesbischen Aktivitäten der 1970er-Jahre bis heute. Was dort bislang jedoch fehlte, waren authentische Stimmen von Zeitzeuginnen.
Deshalb führte ich im Frühjahr 2019 eine Reihe von Interviews mit lesbischen Frauen aus dem Saarland. Die ein- bis zweistündigen Gespräche mit Frauen zwischen 40 und 70 Jahren fanden an Küchentischen und in Büros, zwischen Fotos und Flugblättern statt. Bekannte Aktivistinnen, ehemalige Partylöwinnen und engagierte Aufklärerinnen ebenso wie zurückgezogen lebende Ruheständlerinnen waren unter den Gesprächspartnerinnen. Ein öffentlicher Aufruf über fast alle Print- und Audio-Medien des Saarlandes stieß auf viel Interesse bei Frauenverbänden und ZeitgenossInnen der 1970er-Jahre, führte aber trotz Nachfrage zu keiner einzigen zusätzlichen Interviewpartnerin. Ein Interview wurde später sogar zurückgezogen, weil die Gesprächspartnerin unglücklich mit ihrer Selbstdarstellung war.
In der Breite scheint das Tabu Homosexualität im Saarland, wie Margit B. betont, noch sehr ausgeprägt. Alle persönlich angesprochenen Frauen waren hingegen bereit, sich meinen Fragen in großer Offenheit zu stellen. Sie sahen wohl auch die Chance, sich ihrer eigenen Geschichte zu vergewissern und der Nachwelt einen Eindruck ihrer Lebensumstände dieser Jahre zu hinterlassen. So entstand ein Konvolut von zwölf eindrücklichen Audio-Zeugnissen aus dem lesbischen Leben im Saarland, nachhörbar und nachlesbar in der Datenbank der FrauenGenderBibliothek Saar (FGBS) und auf dem DDF-Portal.1 Einige zentrale Aspekte sollen hier dargestellt werden.
Coming-out in den 1970er-Jahren
Der Einstieg in die Interviews erfolgte über die Frage nach dem Coming-out, für fast jede Lesbe eine einschneidende und unvergessliche Erfahrung. Dem Coming-out voraus ging häufiger, wie zum Beispiel bei Margit B., eine unglückliche heterosexuelle Ehe, zum Teil wider besseres Wissen, weil frau sich die Außenseiterinnen-Rolle nicht zutraute.
Gleichzeitig konnte es im Dorf, in der Kleinstadt unter Umständen auch Rollenvorbilder geben: Zwei meiner Gesprächspartnerinnen, Beate R. und Rebecca S., erwähnen ein älteres Frauenpaar, das mehr oder weniger selbstverständlich in die Dorfgemeinschaft integriert war. Das gemeinsame Schlafzimmer wurde geflissentlich übersehen, die Rollenverteilung neugierig diskutiert, in jedem Fall boten diese Paare dem jungen Mädchen im Identitätsfindungsprozess Anknüpfungspunkte für frühe lesbische Faszinationen. Dennoch schwebte latent immer die Furcht vor Stigmatisierung im Raum.
Und aus Stigmatisierung folgte unter Umständen Schlimmeres: So berichtet Margit B. vom Suizid ihrer ersten Geliebten, für die der Druck der Außenwelt zu stark geworden war. Margit B. hatte sich dadurch zur Flucht aus ihrer angestammten großstädtischen Umgebung (Hamburg) veranlasst gesehen und musste sich einer beruflichen Neuorientierung im weit entfernten Saarland stellen. Auch die Auseinandersetzung mit eigenen suizidalen Wünschen und Versuchen, von denen Irene P. berichtet, macht betroffen. Die frühe Erfahrung von Ablehnung und Ausgrenzung durch Familie und Gesellschaft prägte das Erwachsenwerden vieler homosexueller Jugendlicher und tut dies im Übrigen bis heute, mit teils drastischen Konsequenzen. Selbstmord als Ausweg, ob im Bekanntenkreis und vom Hörensagen, tauchte mehrfach in den Gesprächen auf.
In diesen frühen Jahren erregender und beängstigender Gefühlsverwirrung suchten sich mehrere der Befragten Objekte des Begehrens in Frauen, die als Vorbilder dienen konnten – klassischerweise eine Lehrerin. Beate R. verliebte sich früh in eine bewunderte Lehrerin (und bald auch in eine Bibliothekarin). Irene P.s erste Liebe galt ebenfalls einer Lehrerin, von der sie erschrocken abgewehrt wurde. Später fand sie bei einer anderen Lehrerin Unterstützung. Gisela P.s erste Geliebte war eine (französische) Lehramtsassistentin, der sie nach Frankreich folgte und die sie zur eigenen Berufswahl inspirierte.2 Gemeinsam war fast allen Coming-out-Erzählungen die Bedeutung einer älteren Frau für Orientierung und Schutz in dieser verletzlichen Lebensphase.
Die Eltern fielen meist als Stützen aus, im Gegenteil, oft waren sie Teil des Problems. Erschütternd, wie Irene P. beim späten Heimkommen aus der (Schwulen-)Disko von ihrem Vater, einem Polizisten, mit gezogener (zur Decke gerichteter) Waffe bedroht wurde, woraufhin sie ihr Elternhaus verließ und drei Jahre lang keinen Kontakt mehr pflegte. Auch Edeltrud M. und Heike N. berichten von Scham und Verheimlichung im Elternhaus und in dessen Umfeld. Monika L. hingegen, wiewohl feministisch sehr engagiert, verweigerte sich lange Zeit ganz der (Selbst-)Identifizierung als Lesbe.
Junge Frauen in den 60er- und 70er-Jahren im Saarland – das gerade erst mit zwölf Jahren Verspätung in der jungen Nachkriegs-Bundesrepublik angekommen war – fanden sich zumeist in Klein- und Mittelstädten mit katholischer Prägung und engem sozialem Umfeld wider, wie Edeltrud M. beschreibt. Saarbrücken, unmittelbar an der französischen Grenze gelegen, galt als urbaner Anziehungspunkt und Sehnsuchtsort für alle, die der Enge und sozialen Kontrolle in Dillingen, Homburg oder Ottweiler entkommen wollten.
Lesben in der Subkultur
In dieser schwierigen Situation – katholische Provinz und fehlende Unterstützung durch die Herkunftsfamilie – kam der jeweiligen Peergroup eine immense Bedeutung zu. Frau suchte sich diese zunächst oft in der homosexuellen Subkultur (kurz: der Sub), die eine Art Ersatz-Familie bot. Nicht zufällig wurde in der Erinnerung bei fast allen Gesprächen das Bild einer familiären Gemeinschaft beschworen, der frau sich nun unverbrüchlich zugehörig fühlte, wie zum Beispiel bei Gisela P. und Irene P.3 Dies verwundert nicht angesichts der meist fehlenden Unterstützung durch die Herkunftsfamilie.
Im homosexuellen Nachtleben der Großstadt Saarbrücken differenzierte sich ab den 60er-Jahren zunehmend eine eigenständige lesbische Subkultur heraus. Bekannte Lokale waren über viele Jahre das Sappho und das Moby Dick. Der Sub entfaltete auch deshalb solch große Anziehungskraft, weil tagsüber keine gelebte Homosexualität möglich erschien. Sinngemäß sagte Irene P. dazu: Homosexuell war man nachts4 . Hier fühlte „frau“5 sich frei, ihren Phantasien zu folgen, begehrt zu werden und selbst zu begehren: „Es war eine wilde Zeit, es war eine gute Zeit, (lacht), eine Zeit unter uns.“6 Dass diese Freiheit mit viel Alkohol und einer Verquickung mit dem saarländisch-französischen Rotlichtmilieu – bedingt durch die Grenzlage Saarbrückens – erkauft war, wurde von den Frauen mehr oder weniger kritisch registriert. Ein Teil der Nachtschwärmerinnen störte sich nicht daran, dass die ein oder andere Wirtin auch als Zuhälterin tätig war, und nahm die müden Prostituierten spätnachts am Tresen in die schwesterliche Solidarität mit auf. Margit B. war jahrelang Thekerin in der Lesbenkneipe Moby Dick und richtete hier die erschöpften Erwerbstätigen auf. Zuzeiten musste sie das Lokal aber auch schon mal energisch gegen Rockerbanden und andere männliche Eindringlinge verteidigen. Andere Frauen schreckten vor dieser Vermischung der Milieus entschieden zurück und entzogen sich deshalb der schwul-lesbischen Subkultur, wie im Gespräch mit Beate R. deutlich wird. Diese und weitere Zeitzeuginnen suchten sich deshalb neue Communities und wurden unter anderem in der damals sehr aktiven Frauenbewegung fündig.
Mehr zu diesem Thema im Essay Lesben jenseits der Metropolen: Frauenbewegung, Diskriminierung, Vernetzung.
Fußnoten
- 1Im Archiv der FGBS und in der META-Datenbank unter ARCH-129 zu finden. Transkription Gesine Kleen.
- 2Beate R., Transkription des Interviews, S. 1; Irene P., Transkription des Interviews, S. 1; Gisela P., Transkription des Interviews, S. 1.
- 3Gisela P., Transkription des Interviews, S 7; Irene P., Transkription des Interviews, S. 9.
- 4Irene P., Transkription des Interviews, S. 9.
- 5Im Sinne des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs und passend zum beschriebenen historischen Zeitraum wird statt des Pronomens „man“ als umfassendes Pronomen „frau“ verwendet.
- 6Margit B., Transkription des Interviews, S. 7.