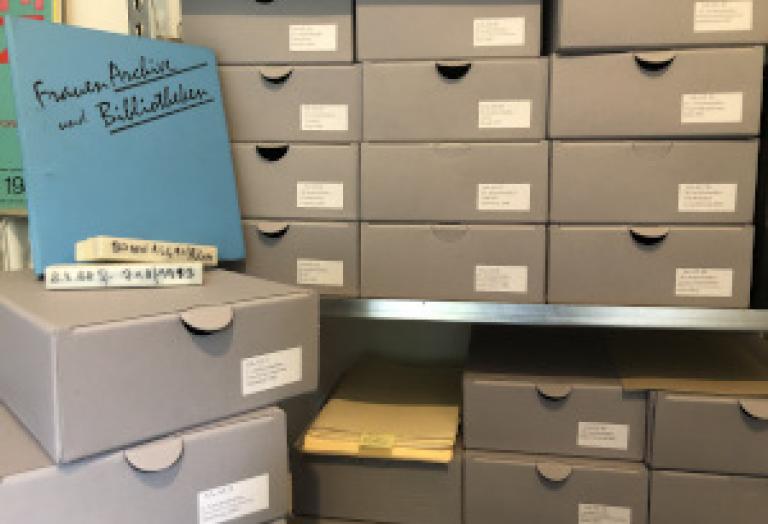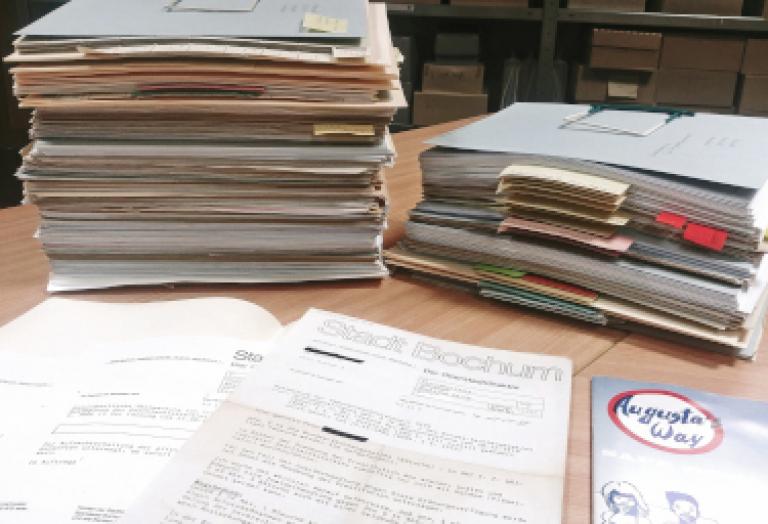„Nun wird es anders“ (Hertha Nathorff) – 1933 und die Frauenbewegung
Männerbilder und Machtgesten: Es sind wiederkehrende Symboliken wie Rhetoriken, die die Berichterstattung um die Machtübertragung 1933 begleiten. Doch wie kann eine geschichtspolitische Intervention umgesetzt sein, die auf heroisierende Abbildungen von NS-Symbolen oder die Übernahme des NS-Sprachgebrauches verzichtet?
Welche Perspektiven und Positionen sind in Berichterstattung und Bildungsarbeit noch immer unterrepräsentiert? Welche Erzählungen thematisieren die Mitläufer*innen und Täter*innen, welche die Opfer und widerständigen Positionen? Welche Bilder und Worte prägen noch 90 Jahre nach der Machtübertragung die Erzählung darüber?
Feministische Einblicke
Mit der neuen Publikationsreihe Infos, Links & Materialien bietet das Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) – insbesondere für Medien und Multiplikator*innen – eine Sammlung von im DDF vorhandenen Beiträgen zu einem Thema. Dies umfasst weder die gesamt Fülle der Bestände der feministischen Erinnerungseinrichtungen, die die Grundlage für das DDF stellen, noch bildet es vollumfänglich die Inhalte vom DDF und seinem META-Katalog, der feministischen Online-Datenbank, ab.
Als Handreichung bietet sie den Einstieg in das Thema und erleichtert die Recherche. Auch begleitet das DDF das Thema mit der Publikation über das gesamte Jahr und unterstützt bei Bedarf gern bei weiterführenden Anfragen. Ansprechbar sind hier vor allem die verantwortliche Redaktion, bestehend aus den DDF-Historikerinnen Dr. Jessica Bock und Dr. Birgit Kiupel sowie der DDF-Kommunikationsleitung Steff Urgast.
„Nun wird es anders“ (Hertha Nathorff) – 1933 und die Frauenbewegung
Vor 90 Jahren ernannte Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler: Diese Machtübertragung besiegelte das Ende der ersten deutschen Demokratie und ebnete der NS-Diktatur den Weg. Auch für die Frauenbewegung bedeutet dies ihr vorläufiges Ende. Unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler begann die Koalitionsregierung aus NSDAP, DNVP und Stahlhelm mit dem Aufbau der NS-Diktatur.
Im Zuge der sogenannten Gleichschaltung und ideologischen Umwälzung geriet auch die Frauenbewegung stark unter Druck: Ihre Organisationen mussten sich entweder NS-Verbänden anschließen oder auflösen, das passive Wahlrecht wurde Frauen entzogen, Berufsverbote eingeführt und z.B. der § 218 verschärft. Die jüdische Ärztin Hertha Nathorff (1895–1987) wusste bereits zur Machtübertragung 1933, welche verheerenden Folge diese haben würde. „Nun wird es anders“1
, hielt sie direkt am 30. Januar 1933 in ihrem Tagebuch fest – und der Bruch kam rasant. Im selben Jahr wurden alle jüdischen Mitarbeiter*innen der Klinik, welche sie in Berlin-Charlottenburg leitete, entlassen. Sie selbst musste 1938 ins Exil fliehen.
Der Jüdische Frauenbund begann, die Emigration jüdischer Frauen und Familien vorzubereiten und Schutzstrukturen aufzubauen, für u.a. lesbische Personen begann die „Zeit der Maskierung“ (Claudia Schoppmann). Viele Akteur*innen flohen ins Exil, wurden verhaftet, aus der Politik und dem öffentlichen Leben verbannt oder ermordet. Biografien wie die von Marie Juchacz, Lida Gustava Heymann oder Emmy Beckmann stehen hier stellvertretend für die zahllosen politisch bewegten Lebensgeschichten von Feminist*innen, die spätestens ab 1933 durch das neue NS-System starke Einschnitte und Repressionen erfuhren.
Kritische Aufarbeitung
Andere versuchten sich mit dem NS-Regime zu arrangieren, profitierten und verstrickten sich mit diesem durch Mitläufer*innentum und Täter*innenschaft. Welche Auswirkungen dies auch auf spätere innerfeministische Debatten hatte, zeigen u.a. die Bestände des feministischen Bildungszentrums und Archivs DENKtRÄUME in Hamburg. Hier finden sich Forschungen, Interviews mit Zeitzeug*innen und Dokumente.
Auch der DDF-Podcast Listen to the Archive greift in der im Januar 2023 erschienen Folge Mit Hass an die Macht – die NS-Machtübernahme 1933 die drastischen antidemokratischen Entwicklungen auf und bietet Einblicke in zeitgeschichtlich spannende Bestände der feministischen Erinnerungseinrichtungen. Hinsichtlich der Entwicklungen für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung der Frauen, empfehlen wir zudem die weiterführende Lektüre des DDF-Dossiers § 218 und die Frauenbewegungen. Debatten – Akteurinnen – Kämpfe.
Die vorliegende Publikation gliedert sich in drei Teile: Geblickt wird auf den Vorabend der Machtübertragung, auf die frauenpolitischen Perspektiven auf das zentrale Jahr 1933 sowie den späteren, auch innerfeministischen Umgang mit der NS-Vergangenheit.
Zum Durchblättern & Download – Infos, Links & Materialien 1/23: „Nun wird es anders“ (Hertha Nathorff) – 1933 und die Frauenbewegung
Fußnoten
- 1Benz, Wolfgang (Hg.): Das Tagebuch der Hertha Nathorff. Berlin - New York, Aufzeichnungen 1933 bis 1945, Frankfurt am Main 2019, S. 35.